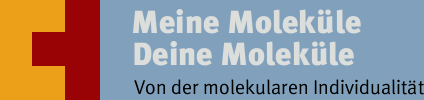Wer wünscht sich nicht den idealen Zustand, Medikamente verschrieben zu bekommen oder daß Therapien angewendet werden, die nur bei ihm optimale Wirkungen entfalten und keine Nebenwirkungen mit sich bringen. So hat es insbesondere in den letzten zehn Jahren nicht an Versuchen (und Versprechungen) gemangelt, sich diesem Ideal zu nähern und spezifische Tests zu entwickeln, um aus bestimmten molekulargenetischen Informationen auf individualspezifische Reaktionsmuster zu schließen. Letztendliches Ziel sollte die Schaffung maßgeschneiderter Medikamente und Verfahren sein, die die obengenannten Erwartungen erfüllen können.
Wenn man jedoch die in der Literatur veröffentlichten Zahlen über die Todesopfer durch Medikamenten-Nebenwirkungen kennt, wird man gewahr, welch aktuelle Bedeutung Forschungen dieser Art besitzen. In den meisten Fällen handelt es sich hierbei allerdings nicht um „Kunstfehler“ der Ärzte. Natürlich gehört es bereits heute zu den differentialdiagnostischen Gepflogenheiten, bei der Risikoabschätzung und Wahl entsprechender therapeutischer Maßnahmen familiäre, also mögliche genetische Belastungen zu berücksichtigen und durch Auswertung der Krankheitsvorgeschichte Informationen über individuelle Besonderheiten zu erfahren.
Heutzutage gleicht jedoch die Therapie vieler Erkrankungen häufig dem berühmten Schießen auf Spatzen mit Kanonenkugeln. So bleibt es nicht aus, daß gerade bei Langzeittherapien irreversible unerwünschte Nebenwirkungen auftreten.
Wenn man weiß, daß in den USA unerwartete Arzneimittelreaktionen zu den fünfthäufigsten Todesursachen gehören und in Deutschland etwa 20.000 Menschen jährlich durch die gleichen Ursachen versterben, so wird deutlich, welch große Bedeutung der Berücksichtigung der individuellen Disposition zukommt.
Deshalb wird viel Geld investiert, um Medikamente zu entwickeln, die möglichst gezielt und nebenwirkungsfrei eingesetzt werden können. Dreh- und Angelpunkt ist die genaue Kenntnis der Wirkorte der zu entwickelnden Pharmaka sowie der Veränderung ihrer chemischen und physikochemischen Eigenschaften zwischen dem Ort der Verabreichung und dem zu behandelnden Organ (Pharmakodynamik, Bioverfügbarkeit), dem Einmaleins der Pharmakologen.
Jedoch sind aufgrund der komplexen genetischen Zusammenhänge und des fast grenzenlosen Polymorphismus auf Genom- und Eiweißebene in naher Zukunft kaum einfache und praktisch handhabbare Lösungen zu erwarten. Nebenwirkungen können darüberhinaus nur in beschränktem Umfang vorausgesagt werden, da sie nicht nur von bestimmbaren Faktoren des genetischen Backgrounds abhängen, sondern vielmehr von der molekularen Disposition zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Wirkort. Genau genommen muß damit gerechnet werden, daß die molekularen Bedingungen in jedem Moment des Individuallebens anders sind.
Bisher wurden Medikamente nur nach recht groben Kriterien wie Gewicht, Geschlecht und Alter oder Leber- und Nierenfunktion und eventuellen Wechselwirkungen mit gleichzeitig applizierten Arzneimittel dosiert. Heute sucht man nach den kleinen individuellen genetischen Unterschieden, z.B. den weiter oben beschriebenen SNPs (vgl. Abschnitt „Polymorphismus“), die Einfluß auf die Verwertung von Medikamenten haben oder die die Angriffspunkte für Medikamente verändern können. Als Werkzeug für das Screening und die schnelle Diagnose solcher individuellen „Krankheitsvarianten“ bieten sich die DNS-Chips an. Die individuelle molekulare Ausstattung des einzelnen Patienten spielt dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle, d.h. jeder Patient kann anders auf das gleiche Medikament oder die gleiche Dosis reagieren. Zu den genannten genetischen kommen noch bestimmte epigenetische Faktoren (vgl. Abschnitt „Epigenetik“), die im Laufe des Lebens erworben wurden.
Eine genetische Veranlagung allein muß nicht krank machen, meist kommen äußere Auslöser hinzu – wie Ernährung und Umwelteinwirkungen. Gerade chronisch-degenerative Krankheiten entwickeln sich oft über Jahrzehnte. Im Krankheitsverlauf ändert sich die Aktivität der Gene. Kennt man das Zusammenspiel der genetischen und umweltbedingten Faktoren, so bestünden in gewissem Maße neue Möglichkeiten, Krankheiten gezielt vorzubeugen. So liefert die Identifizierung der jeweils aktiven Gene den Schlüssel, um die funktionellen Zusammenhänge für die Entstehung von Krankheiten und die toxikologischen Wirkungen von Medikamenten und Umweltschadstoffen aufzuklären (vgl. Abschnitt „Das Transkriptom“).
Es ist also verständlich, daß es gegenwärtig zu den großen Herausforderungen der biowissenschaftlichen Forschung gehört, die Struktur krankheitsrelevanter Biomoleküle und deren funktionelle Dynamik aufzuklären. Es geht um keinen geringeren Wunsch als voraussagen zu können, wie welcher Mensch mit welchem Medikament reagieren wird (prädiktive Diagnostik).
Nun könnte man vielleicht meinen, das Problem wäre mit der Aufklärung des Genoms des Menschen gelöst. Wie wir aber weiter oben bei der Betrachtung der Beziehungen zwischen Genom, Transkriptom und Proteom bereits erfahren haben, stehen die Forscher vor dem großen Problem der individuellen Vielfalt – insbesondere auf der Proteinebene. Sie ist zwar primär in den unterschiedlichen Nukleotidsequenzen abgebildet, widerspiegelt aber nur einen Teil der Wechselwirkungsmöglichkeiten auf der Protein- und Zellebene. So spricht man heute bereits von der Ära der „Postgenomics“, also von alledem, was nach der Aufklärung des Genoms des Menschen kommt. Übrigens liegt in dieser sogenannten funktionellen Genetik einer der Schwerpunkte der deutschen biowissenschaftlichen Forschung.
Auf diesem Hintergrund sind bereits ganz neue biowissenschaftliche Arbeitsgebiete entstanden wie die Pharmakogenetik, die sich mit den krankheitsrelevanten Genen und deren Genprodukten beschäftigen. Letztere bilden die interessierenden Zielstrukturen (Targets) bei der Suche nach künftigen Medikamenten. Zur Zeit sind mehr als 500 solcher Targets für Medikamente bekannt. Deren Zahl wächst aber ständig mit der Kenntnis neuer Genprodukte.
Zur Sicherung oder Bestätigung von Ergebnissen anderer diagnostischer Verfahren steht die Anwendung gentechnischer Methoden außer Frage. Sie macht jedoch in großem Stil nur Sinn, wenn sie als Massentest ( Biobanken ) verfügbar und erwünscht ist. Die Konsequenz ist allerdings, daß große Populationen der Bevölkerung untersucht und genetische Profile von jedem untersuchten Individuum aufgestellt werden müßten.
Fazit: Die heutige Therapie mit Medikamenten ist nur in geringem Maße dazu geeignet, auf die molekularen Voraussetzungen des einzelnen Patienten einzugehen. Folge sind zum Teil schwere Nebenwirkungen und eine nicht zu vernachlässigende Zahl von Todesfällen. Individuelle Therapien setzen jedoch neben der Kenntnis der Wirkmechanismen der eingesetzten Pharmaka das Wissen um die individuellen molekularen Zielstrukturen (Wirkorte) und ihre Dynamik voraus. Sie bilden gegenwärtig einen Schwerpunkt biowissenschaftlicher Forschung.